Sie möchten Ihre Reha- oder Kur richtig beantragen? Hier finden Sie Informationen und Hilfe beim Ausfüllen des Reha-Antrags.
Allgemeines
Rehakliniken
Rehazentrum
Menschen mit einer Reizblase leiden unter einem quälenden, oft plötzlich auftretenden Harndrang. Die Medizin kennt dieses Phänomen der überaktiven Blase auch als Urethralsyndrom. Dabei handelt es sich um eine Funktionsstörung, bei der die Blase das Signal zur Entleerung bereits an das Gehirn sendet, bevor sie gefüllt ist. Der Toilettengang ist damit eigentlich noch längst nicht nötig. Gleichzeitig kommt es bei Patient:innen immer wieder vor, dass die Blase unkontrolliert einige Tropfen Harn abgibt. Die Erkrankung ist damit für Betroffene unangenehm und schambehaftet. Glücklicherweise gibt es Möglichkeiten der Reizblase-Behandlung durch Medikamente, Physiotherapie und OPs.
Während das Gehirn das Entleerungssignal durch Zusammenziehen der Blasenmuskulatur bei gesunden Menschen ab einem „Füllstand" von 300 ml Urin aussendet (das maximale Füllvermögen der Blase liegt bei ca. 500 ml), erfolgt das Signal zum Entleeren der Blase bei Betroffenen einer Reizblase beispielsweise schon, wenn die Blase erst zu zehn Prozent gefüllt ist. Der Informationsfluss funktioniert also nicht mehr einwandfrei.
Nur in wenigen Fällen, wie etwa bei Morbus Parkinson oder anderen neurologischen Erkrankungen, ist bislang wissenschaftlich eindeutig geklärt, weshalb es im Nervensystem zu dieser Fehlsteuerung kommt. Die Ursache der Funktionsstörung bei einer Reizblase ist in vielen anderen Fällen noch nicht vollständig geklärt. Nichtsdestotrotz ist es möglich, die Symptome der Reizblase zu behandeln.
Der Leidensdruck der Patient:innen ist bei einer Reizblase in der Regel hoch. Nicht nur der ständige Harndrang wirkt sich belastend aus, oft geht das Urinieren zum Ende hin mit Schmerzen einher. Teilweise bereitet auch das „Nachträufeln“ Probleme, wenn kurz nach dem eigentlichen Wasserlassen noch tröpfchenweise Urin auftritt. All diese Symptome können auch während der Nacht auftreten und den Schlaf stören.
Trotz der Einschränkungen in ihrer Lebensqualität durch die überaktive Blase scheuen Betroffene aus Scham oder auch der (falschen) Annahme, dass es keine Behandlungsmöglichkeiten bei einer Reizblase gibt, den Gang zu einem Facharzt oder einer Fachärztin. Vor allem Frauen zwischen 30 und 50 Jahren gehören zu dieser Gruppe, die dadurch nicht erfahren, dass es inzwischen gleich eine Reihe von Therapien gibt, die bei einer hyperaktiven Blase gut wirken.
Der erste Schritt in Richtung eines Lebens ohne ständigen Harndrang ist eine gründliche Untersuchung beim Hausarzt beziehungsweise der Hausärztin und im Anschluss die Überweisung zu einem Urologen, einer Urologin, einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin. Hier ermittelt eine Prostatauntersuchung oder Gebärmutteruntersuchung, ob organische Gründe für die hyperaktive Blase vorliegen. Auch regelmäßige Medikamenteneinnahmen werden hier hinsichtlich der Nebenwirkung des erhöhten Harndrangs geprüft. Eine Urinprobe gibt Aufschluss darüber, ob krankheitserregende Keime im Körper verbreitet sind. Die sogenannte urodynamische Untersuchung ermittelt die Harnstrahlqualität und misst schließlich mittels Ultraschalles die Füllung der Blase, d.h. ob nach der Blasenentleerung Restharn zurückbleibt.
Steht nach Beendigung der Untersuchungen die Diagnose Reizblase fest, kann die Reizblasen-Behandlung auf mehreren Ebenen beginnen:
Für die Patient:innen kommt es jetzt auf Geduld und Konsequenz an. Die Therapie ist langwierig und schnelle Erfolge sind eher die Ausnahme als die Regel. Doch schon im Vorfeld können einige Schritte die Lebensqualität entscheidend verbessern:
Von einer beliebten Form der Selbstbehandlung (Reduktion der Trinkmenge) ist hingegen abzuraten. Diese schadet mehr als dass sie nutzt. Die Blase benötigt ausreichend Flüssigkeit, um gesundzubleiben oder es wieder zu werden.
Je größer die Abstände zwischen den Toilettengängen sind, desto geringer ist der Leidensdruck für die Betroffenen. Das Hinauszögern der Entleerungsintervalle ist daher oft ein wichtiger Baustein in der Reizblase-Behandlung. Erreichen lässt sich dieses Ziel mittels:
Unterstützend wirken zudem
Beim Blasentraining gibt eine Art „Stundenplan" vor, zu welchen Zeiten Patient:innen die Toilette aufsuchen. Indem sie die Zeiten unabhängig von der Stärke des Harndrangs einhalten, erfahren die Betroffenen, dass ihre Blase weit aufnahmefähiger ist, als angenommen. Sie lernen, ihrer Harnblase wieder zu vertrauen. Auch wenn dies oft ein langwieriger und schwieriger Prozess ist, ist die Erfolgsquote gerade bei leichten bis mittelschweren Fällen gut.
Die Reizstromtherapie arbeitet mit schwachen Stromimpulsen. Sie ist eine weitere erprobte Möglichkeit, die überaktive Blase in den Griff zu bekommen und die Muskeln der Harnblase über mehrere Monate hinweg mit Reizstrom "fit" zu machen.
Es gibt eine Reihe von Medikamenten zur Reizblasen-Behandlung. Die sogenannten Anticholinergika dämpfen die Nervenimpulse, die den übermäßigen Harndrang verursachen. Viele der verschreibungspflichtigen Medikamente haben gleich mehrere Nebenwirkungen wie
Treten Unverträglichkeiten auf, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin, um ein anderes Präparat auszuprobieren. So gibt es mittlerweile Anticholergika, die nicht oral eingenommen, sondern als Pflaster angewendet werden und deutlich weniger Nebenwirkungen haben. Es ist in jedem Fall sinnvoll, ein Medikament über mehrere Wochen hinweg zu testen, bevor ein Abbruch der Reizblasen-Behandlung erfolgt.
Die Gruppe der sogenannten Beta-3-Agonisten bremst die Aktivität der Blasenmuskulatur und verringert so den Harndrang. Auch bei diesen Medikamenten sind Nebenwirkungen möglich.
Ist die Reizblase ein Problem der Wechseljahre und des damit verbundenen sinkenden Östrogenspiegels, hilft eine lokale Östrogentherapie. Durch das Einführen von Östrogenen in Salben- oder Cremeform in die Vagina profitiert bei konsequenter Anwendung die Elastizität des Beckenbodens. Alternativ ist auch die Einnahme von Östrogen in Tablettenform wirksam.
Der Vollständigkeit halber ist auch die Wirksamkeit der Injektion von Botox in die Harnblase zu nennen. Allerdings ist diese Behandlungsform nur zeitlich eingeschränkt möglich und sinnvoll.
Ein Blasenschrittmacher erleichtert in der Regel querschnittgelähmten Menschen den Alltag, kann aber auch die Lebensqualität von Patient:innen bei schwerwiegenden Problemen mit einer Reizblase deutlich verbessern. Der Schrittmacher steuert dabei mit schwachen und ungefährlichen elektrischen Impulsen die Nervenfasern und verhindert einen unkontrollierten Harnverlust.
Neben den Möglichkeiten der Schulmedizin können bei der Reizblase-Behandlung auch zum Beispiel Präparate aus Bärentraubenblättern eingesetzt werden. Die Wirksamkeit dieser Behandlungen ist wissenschaftlich allerdings nicht belegt.
Leiden Sie unter den Symptomen einer Reizblase, bieten wir die Möglichkeit, diese im Rahmen eines zwei- bis dreiwöchigen Präventionsprogramms „Beckenboden stark“ untersuchen zu lassen und die Symptome der Reizblase zu behandeln. Das Ziel dieser Maßnahme auf Selbstzahlerbasis ist die Verbesserung des Wasserlassens und eine Stärkung der Beckenbodenmuskulatur. Haben Sie Fragen zu unserem Beckenbodenprogramm oder möchten Sie dieses telefonisch buchen, kontaktieren Sie unsere Kolleg:innen unserer Reservierungsabteilung unter 09708 79-3492.
Weitere Übungen für das Beckenbodentraining Zuhause finden Sie hier: https://www.hescuro.de/uebungen/beckenbodentraining/.

Facharzt für Urologie
MD, Ph.D
Tätigkeitsschwerpunkt
Andrologie/Sexualstörungen

Facharzt für Urologie
Medikamentöse Tumor-
therapie
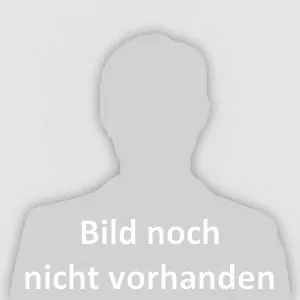
Telefon: 09708 79-9344
E-Mail: bb-sek-urologie@hescuro.de
Informationen zum Reha-Ablauf
Sie möchten Ihre Reha- oder Kur richtig beantragen? Hier finden Sie Informationen und Hilfe beim Ausfüllen des Reha-Antrags.
Sie haben die Möglichkeit als Begleitperson zur Reha gemeinsam mit Ihrem Partner an der Reha teilzunehmen und beispielsweise Ihre Gesundheit checken zu lassen.
In unserem Downloadbereich können Sie unsere aktuellen Flyer und Prospekte zur Kur & Rehabilitation kostenfrei herunterladen.
Damit Sie Ihre Rehamaßnahme bei uns durchführen können, haben wir einige Infos zum Wunsch- und Wahlrecht zusammengestellt.
Highlights Bad Bocklet
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen